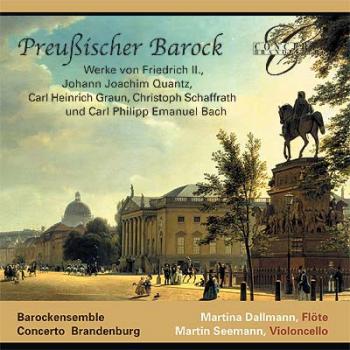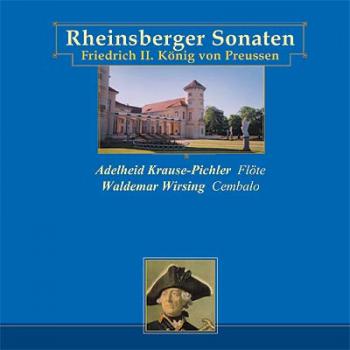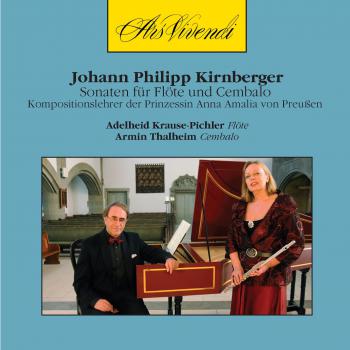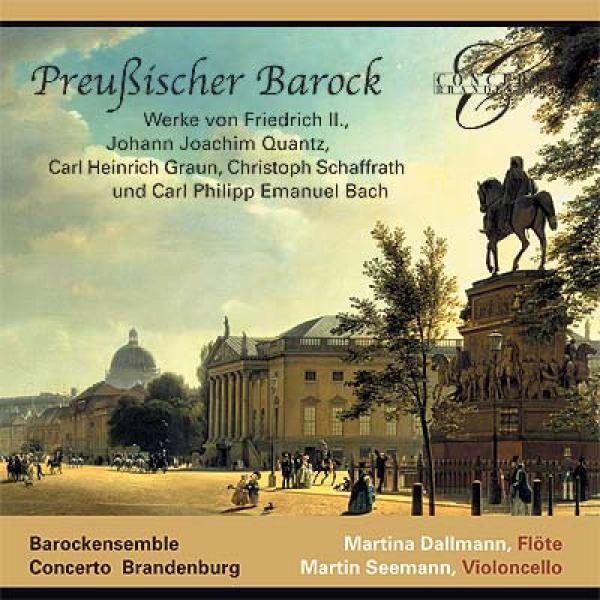

Preußischer Barock
Das Barockensemble Concerto Brandenburg spielt Werke von Friedrich II., Johann Joachim Quantz, Carl Heinrich Graun, Christoph Schaffrath und Carl Philipp Emanuel Bach. Aufnahmen Hochmeistersaal Berlin/ Konzertsaal der UdK Berlin, 2001
TT 62:06 Min., Best.-Nr.: CD 10343, EAN 4260031183431, VÖ PICAROmedia/ primTON 01.09.2003
Inhalt
Johann Joachim Quantz (1697-1773): Flötenkonzert A-Dur, Solistin: Martina Dallmann
Carl Heinrich Graun (1703-1759): Sinfonia C-Dur
Christoph Schaffrath (1709-1763): Overtüre d-Moll
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): Cellokonzert A-Dur Wq 172, Solist: Martin Seemann
Schauen Sie sich bei Youtube Videos an:
 Concerto Brandenburg: Preußischer Barock
Concerto Brandenburg: Preußischer Barock
Die Begeisterung Friedrichs II. für Philosophie, Literatur und Musik und seine persönlichen Fähigkeiten als Flötist und Komponist führten zu einer regelrechten musikalischen Blütezeit Berlin-Brandenburgs und der Entwicklung der Metropole zu einer der musikalischen Hochburgen im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Konnte die musikalische Elite nach der Krönung des Musen-Kaisers im Jahre 1740 ohne Einschränkung das förderliche Klima im Umfeld des musischen Herrschers genießen, so profitiert nun im nachhinein auch der Hörer von diesem preußischen Kulturnachlass.
Bezeichnend für den preußischen Barock legte Friedrich II. in seinen Werken mehr Wert auf die Erfüllung stilistischer Normen, die er vor allem der italienischen Musik entlieh. Für die CD wurde seine Sinfonie Nr. 1 G-Dur eingespielt, obwohl er selbst einen Großteil seiner kompositorischen Konzentration auf das Schreiben von Solosonaten und Konzerten für die Flöte legte, die er selbst in virtuoser Perfektion beherrschte.
Auch sonst war es natürlich für die Musiker und Komponisten, die sich bei Hofe um Ihren Herren versammelten nicht leicht, aus dessen Schatten zu treten. Einer, dem dies gelang, war Friedrichs Flötenlehrer und Kammermusiker sowie Komponist Johann Joachim Quantz, dessen Flötenkonzert A-Dur hier zu hören ist.
Überhaupt zog Friedrich II. umfassend Nutzen aus seinen Hofmusikern. So war Carl Heinrich Graun, dessen Sinfonia C-Dur hier vorliegt, als Kammermusiker und gleichzeitig als Kompositionslehrer beschäftigt. Während Graun ein Vertreter des italienischen Stils war, folgte der Cembalist Christoph Schaffrath eher dem französischen Vorbilde, was man bei der Ouvertüre d-Moll schon am Titel erkennen kann.
Einer der wenigen, die aus der preußischen Tradition musikalischer Korrektheit, Formerfüllung und Disziplin ausbrachen und unkonventionellere Ansätze einbrachten, war der Cembalist, Musiklehrer und Komponist Carl Philipp Emanuel Bach, der dritte Sohn Johann Sebastian Bachs. Obwohl dieser wohl einer der innovativsten Komponisten und bedeutendsten Musiker Friedrichs gewesen sein dürfte, hat er doch offiziell nie den Status der Herren Quantz oder Graun erreicht. Für diese CD wurde sein Cellokonzert A-Dur eingespielt.
Preußischer Barock - Komponisten am Hof Friedrichs II.
Flötenkonzert Friedrichs des Großen – In dem bekannten Gemälde Adolf von Menzels spiegeln sich Glanz und Widersprüche einer musikalischen Blütezeit Berlin-Brandenburgs, die nicht erst bei Entstehung des Bildes um 1850 einer vergangenen politischen und musikalischen Epoche angehörte. Lebendig tritt die kulturelle Ausnahmesituation am Hof des musikliebenden Herrschers hervor, der einen erheblichen Teil der musikalischen Elite des deutschsprachigen Raums beschäftigte: So zeigt das Bild etwa Friedrichs Operndirektor C. H. Graun sowie seinen Flötenlehrer und Kammerkompositeur J. J. Quantz als privilegierte Zuhörer, C. Ph. E. Bach als begleitenden Cembalisten. Die renommierten Musiker hingen weitgehend von der persönlichen Hofhaltung des im Bildmittelpunkt musizierenden königlichen Solisten ab, auf den allein die Aufmerksamkeit von Publikum und Kapelle gerichtet ist. Nicht nur das von Menzel imaginierte Konzert, sondern das gesamte höfische Musikleben einschließlich der Oper bildeten ein wohlbestalltes Auditorium, zugleich aber auch einen glänzenden Käfig für die Musiker.
Als der Engländer Charles Burney, Europareisender in Sachen Musikgeschichtsschreibung, sich 1772 in Berlin und Potsdam aufhielt, lernte er die dortigen Musiker und Musikverhältnisse kennen und wurde zu einem der königlichen Kammerkonzerte eingeladen: „Ich ward nach einem innern Zimmer des Palastes geführt, worin die Herrn von des Königs Kapelle auf seinen Befehl warteten. Dieses Zimmer war dicht an dem Konzertgemache, in welchem ich Se. Majestät ganz deutlich Solfeggi spielen und sich so lange mit schweren Passagien üben hören konnte, bis Sie die Musik hineinzutreten befohlen. [...] Die Musik begann mit einem Flötenkonzerte, in welchem der König die Solosätze mit großer Präzision vortrug. [...] Kurz, sein Spielen übertraf in manchen Punkten alles, was ich bisher unter Liebhabern oder selbst von Flötenisten von Profession gehört hatte. Se. Majestät spielten drei lange und schwere Konzerte gleich hintereinander und alle mit gleicher Vollkommenheit.” Höflich, aber unbestechlich formuliert Burney bei allem Lob jedoch den Eindruck der Antiquiertheit der erklingenden Musik Es handelte sich um Konzerte von Quantz, die zum beinahe ausschließlichen Repertoire des Monarchen gehörten. Dabei bemerkt er die herausgehobene Rolle von Friedrichs Flötenlehrer: „Herr Quantz hatte bei dem Konzert heute abend nichts zu tun, als bei dem Anfange eines jeden Satzes mit einer kleinen Bewegung der Hand den Takt anzugeben, außer dass er zuweilen am Ende der Solosätze und Kadenzen ‚Bravo!‘ rief, welches ein Privilegium zu sein scheint, dessen sich die übrigen Herrn Virtuosen von der Kapelle nicht zu erfreuen haben.” Schließlich fasst Burney seine Eindrücke der höfisch geprägten preußischen Musikszene mit feiner Ironie zusammen: „Die Musik hierzulande ist deutscher als in irgendeiner andern Gegend des deutschen Reichs. [...] Und der König hält in dem Opernhause ebensowohl auf gute Mannszucht als im Felde, und wenn an beiden Orten der geringste Fehler in einer einzigen Bewegung oder Evolution vorfällt, so wird er bemerkt und der Fehlende zurechtgewiesen. [...] Diese ist gar eine vortreffliche Methode, wenn die Komposition gut und der Sänger zügellos ist; sie steht aber auch gewiss dem Geschmacke und dem Raffinement entgegen. Bei alledem aber steht hier der Geschmack in der Musik auf einem festen und unbeweglichen Punkte.”
In Burneys Kritik zeigt sich deutlich, wie schnell sich die musikalische Entwicklung in Europa damals vollzog, wie schnell einstmals avancierte Musik als veraltet galt, wenn sie sich von diesen Entwicklungen ausschloss. Seine Kritik enthält aber auch schon die Andeutung einer Erklärung, nämlich den recht konservativen, „auf einem festen und unbeweglichen Punkte” verharrenden Geschmack des Fürsten, dem seine Musiker sich anzupassen hatten: Die Konzerte, die der Engländer zu hören bekam, mögen zwanzig oder – wie er selbst vermutet – teilweise vierzig Jahre alt gewesen sein. An ihrer Beschaffenheit hätte das nur wenig geändert. Für den Hörer des 21. Jahrhunderts freilich spielen diese Fragen damaliger europäischer Musikkritik, auch die Frage, wie sich Quantz und andere Komponisten des Hofes – etwa die Brüder Benda und Graun, C. Ph. E. Bach und Schaffrath – ohne die Maßgaben Friedrichs entwickelt hätten, eine geringe Rolle. Ihre Werke erschließen sich heute vor allem aus ihrer individuellen Qualität und diese Qualität wurde wesentlich von den professionellen musikalischen Verhältnissen der preußischen Residenz ermöglicht.
Die vehemente Missbilligung, die Friedrich Wilhelm I. der Neigung seines Sohnes zu Philosophie, Literatur und Musik entgegenbrachte, zwang den Kronprinzen Friedrich gelegentlich zu einer gewissen subversiven Heimlichkeit, etwa – wie Burney von Quantz erfuhr – der Veranstaltung von Konzerten „in einem Walde oder in einem unterirdischen Gewölbe”. Trotz der väterlichen Ressentiments unterhielt Friedrich in seinen Residenzen – in Ruppin, später in Rheinsberg – ein Kammerorchester und nahm Flöten- und Kompositionsunterricht. Kaum war er als Friedrich II. seinem Vater 1740 auf dem preußischen Thron gefolgt, baute er sein Orchester zur Königlichen Kapelle aus und schickte seinen Kapellmeister C. H. Graun auf Italienreise, um Sängerpersonal für die Oper anzuwerben. Ein adäquates Gebäude dafür gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Der Bau wurde jedoch ebenfalls unverzüglich begonnen und das Königliche Opernhaus in Berlin konnte 1742 – mit einer italienischen Oper Grauns – eröffnet werden. 1748 wurde eine weitere Spielstätte im Potsdamer Stadtschloss eingerichtet. Doch das musenfreundliche Klima vor allem der ersten eineinhalb Jahrzehnte von Friedrichs Herrschaft war nicht auf seine Schlösser und auf die Hofoper beschränkt, sondern inspirierte auch die bürgerliche Musikpflege, die von der Anwesenheit der prominenten Hofmusiker in hohem Maße profitierte. Während im Königlichen Opernhaus ausschließlich Opere Serie, vornehmlich von C. H. Graun und J. A. Hasse gespielt wurden, amüsierte man sich in den bürgerlichen Salons schon 1743 über eine englische Parodie des italienischen Genres. C. P. E. Bachs Dienst als Begleitmusiker bei Hofe ließ ihm ausreichend Zeit, solistische Cembalomusik für die Salons zu schreiben und zu unterrichten; und neben ihrer Konzerttätigkeit für das Königshaus wirkten etwa Bach und C. H. Graun auch als Komponisten der ‚ersten Berliner Liederschule‘. Deren Bestrebung, in Abgrenzung von italienischem Operngesang einerseits, vom volkstümlichen Lied andererseits, einfache und singbare Tonsätze zu komponieren, basierte auf gemeinsamen ästhetischen und poetischen Positionen und trat publizistisch prominent erstmals mit der von Chr. G. Krause und K. W. Ramler herausgegebenen Sammlung Oden mit Melodien (1753) in Erscheinung.
Überhaupt florierte im aufgeklärten Berlin der Druck von Noten und Büchern, so dass die Stadt mit ihrem höfischen Spitzenorchester und der reichen bürgerlichen Musikpflege Mitte des 18. Jahrhunderts nicht nur zu einer der musikalischen Hochburgen des deutschsprachigen Raums aufgerückt war, sondern auch zum Zentrum der Musiktheorie und -kritik. Heftig wurde um musikästhetische Fragen gestritten, etwa diejenige, ob dem französischen oder dem italienischen Stil der Vorrang gebühre. Mit teils rüden verbalen Attacken prallten beispielsweise Fr. W. Marpurg, der sich 1749 als Critischer Musicus an der Spree für die französiche Musik aussprach, und J. Fr. Agricola, der gegen Marpurg und für den italienischen Stil polemisierte, aufeinander. Auch J. J. Quantz, dessen Schüler Friedrich II. ein Anhänger der italienischen Musik war, griff in diese Fehde ein, indem er im Schlussabschnitt seines Versuchs einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen (1752) salomonisch für eine Synthese plädierte: „Wenn man aus verschiedener Völker ihrem Geschmacke in der Musik, mit gehöriger Beurtheilung, das Beste zu wählen weiß, so fließt daraus ein vermischter Geschmack, welchen man, ohne die Grenzen der Bescheidenheit zu überschreiten, nunmehr sehr wohl den deutschen Geschmack nennen könnte.” Dass Quantz diese ästhetischen Erwägungen in seiner Flötenschule ausbreitet, zeigt, welch weit gesteckten didaktischen Anspruch solche Lehrwerke damals verfolgten. Ein Anspruch, der auch dem Geist der Aufklärung zu verdanken war. Dass aber musiktheoretische Debatten schwerlich origineller als die Musik sein können, an der sie sich entzünden, darauf verwies Charles Burney zwei Jahrzehnte später: „In Berlin sind mehr musikalische Streitschriften und mit mehr Hitze und Eifer gewechselt worden als anderwärts. Es gibt in dieser Stadt auch wirklich mehr theoretische als praktische Tonkünstler, und das hat vielleicht weder den Geschmack verfeinert noch die Phantasie begeistert.”
Friedrich II. (1712 – 1786) pflegte und beförderte das literarische und musikalische Leben nicht nur, sondern wurde in beiden Bereichen auch schöpferisch tätig. Er erwarb, neben seinen virtuosen Fähigkeiten auf der Flöte, als Schüler C. H. Grauns (und Quantz’) auch kompositorische Fertigkeit. Zwar stand dabei die Musik für sein eigenes Instrument und also für den eigenen Gebrauch mit 121 Solosonaten und vier Konzerten ganz deutlich im Vordergrund. Standesgemäß komponierte er auch Märsche. Darüber hinaus entstanden zudem einige Opernarien und Sinfonien, bei denen die ausschließliche Autorschaft Friedrichs allerdings nicht ganz klar ist. Die 1. Sinfonie in G-Dur für Streichorchester wurde vermutlich während der Rheinsberger Zeit des Kronprinzen, also zwischen 1736 und 1740, komponiert. Friedrich hatte schon früh eine große Vorliebe für italienische Musik. Es erstaunt also nicht, wenn seine eigene G-Dur-Sinfonie ihrer formalen Anlage und dem harmonisch-melodischen Duktus nach dem verbreiteten Muster der italienischen Opernsinfonia entspricht. Gelegentlich sind in der Forschung die Grenzen von Friedrichs kompositorischen Fähigkeiten bemerkt worden. Ob die unkomplizierte, durchweg homophone Anlage seiner Kompositionen solcher Beschränkung oder schlicht seinem Geschmack – oder aber vielleicht beidem – entsprang, muss nicht beantwortet werden, um ein unterhaltsames Werk wie die G-Dur-Sinfonie zu goutieren. Dieses Werk zielt nicht auf Innovation und Originalität, sondern auf Erfüllung stilistischer Normen.
Johann Joachim Quantz (1697 – 1773) kam 1718 als Oboist an den Hof Augusts des Starken nach Dresden. In der berechtigten Überzeugung, sich mit der Flöte eher profilieren zu können, widmete er sich in der Folge verstärkt diesem Instrument. Zwischen 1724 und 1727 reiste er durch Italien, Frankreich und England, wo er mit vielen namhaften Musikern in Kontakt kam und sich auch kompositorisch weiter entwickelte. Nach seiner Rückkehr nach Dresden wurde Quantz erster Flötist in Augusts Königlicher Kapelle, die als eine der führenden in Europa galt und später auch als Vorbild fürs preußische Hoforchester diente. Der preußische Kronprinz Friedrich hörte Quantz 1728 in Dresden und nahm in den Folgejahren bei ihm Flötenunterricht. Als er den Thron bestieg, holte er seinen Lehrer als Kammermusiker und Kammerkompositeur an seinen Hof, wo Quantz bis zu seinem Tod unter finanziell ausgezeichneten Bedingungen blieb. Ein großer Teil von Quantz’ etwa 300 Flötenkonzerten und fast 200 Sonaten entstand dort. Diese Werke waren fast ausschließlich für den Gebrauch bei den königlichen Konzerten bestimmt, so dass Quantz als Komponist von der öffentlichen Bühne Abschied nahm. Deshalb wurde er durch seinen 1752 erschienenen Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen wohl bekannter als durch seine Musik. Dieses Missverhältnis dürfte sich bis heute erhalten haben. In seinem Versuch – Lehrwerk der Instrumentaltechnik und Orchesterpraxis ebenso wie musiktheoretisch-ästhetischer Codex des musikalischen Status quo – gibt Quantz auch detailliert Auskunft über die rechte Art, ein Solokonzert zu verfertigen, nach der Maßgabe seiner eigenen kompositorischen Praxis. Diese war wesentlich vom Vorbild Antonio Vivaldis inspiriert, was auf großformaler Ebene schnell in der dreisätzigen Anlage und in der Ausgestaltung der Einzelsätze im Wechsel von Tutti-Ritornell und Episoden des Soloinstruments sinnfällig wird. Das Konzert in A-Dur für Flöte und Streichorchester, das wohl Mitte der 1760er Jahre entstand, ist in vieler Hinsicht ein typisches ‚Quantz-Konzert‘ und spiegelt seine kompositorischen Maximen.
Zur Hochzeit des Kronprinzen Friedrich mit Elisabeth Christine von Braunschweig 1733 erklang eine italienische Oper mit dem hoffnungsvollen Titel Lo specchio della Fedeltà (Der Spiegel der Treue), Komponist war der Braunschweiger Tenor und Vizekapellmeister Carl Heinrich Graun (1703 oder 1704 – 1759). Zwei Jahre später trat er als Kammermusiker und Kompositionslehrer in die Dienste Friedrichs, der damals noch in Ruppin residierte und unter dessen Musikern auch schon Carl Heinrichs älterer Bruder Johann Gottlieb Graun (1702 oder 1703 – 1771) war. Beide Grauns waren in Dresden Schüler J. G. Pisendels gewesen. Der Geigenvirtuose Johann Gottlieb hatte für einige Zeit auch Unterricht bei Giuseppe Tartini. Nach der Thronbesteigung Friedrichs wurde Johann Gottlieb Königlicher Konzertmeister und Carl Heinrich Kapellmeister. In dieser Funktion betraute der König ihn mit dem Aufbau des Berliner Opernhauses, das 1742 mit einer Oper C. H. Grauns eröffnet und bei Ausbruch des Siebenjährigen Krieges 1756 mit einem seiner Werke wieder geschlossen wurde: In diesem Zeitraum komponierte er 27 Opern und arrivierte – neben Johann Adolf Hasse – zum wichtigsten Vertreter des italienischen Genres in Deutschland. Viele Werke der Brüder Graun sind schlicht mit “Graun” gezeichnet und lassen sich daher keinem der beiden zweifelsfrei zuweisen – so bislang auch die hier eingespielte Sinfonia in C-Dur für Streichorchester, die um 1749 komponiert worden ist. Das italienische Modell dreiteiliger Orchesterstücke – prototypisch mit der auch fürs Solokonzert gebräuchlichen Satzfolge schnell–langsam–schnell – verbreitete sich seit etwa 1700 in ganz Europa, und zwar als festliches, theatral integriertes Einleitungsstück für die Oper einerseits, andererseits zunehmend als groß besetzte Instrumentalmusik für den höfischen und bürgerlichen Konzertsaal. Zu den prominenten Komponisten von Opern-Sinfonien im deutschsprachigen Raum gehörten die prominenten Opernkomponisten J. A. Hasse und C. H. Graun. Einer der Exponenten der Konzert-Sinfonie im nördlichen Deutschland wiederum waren mit fast hundert Beiträgen zu dieser Gattung J. G. Graun und mit einigen wenigen, dafür recht eigenwilligen Exemplaren C. Ph. E. Bach. Wenn es heute, mit dem Wissen um längerfristige musikgeschichtliche Entwicklungen – etwa in Mannheim, dann auch in Wien – so erscheint, dass „die preußische Symphonik einerseits durch ihre außer bei C. Ph. E. Bach eher geringe Entwicklungsdynamik, andererseits wegen ihrer durch den Siebenjährigen Krieg bedingten kurzen Lebensdauer kaum eine Wirkung gehabt” habe (Ludwig Finscher), so schmälert das den hohen technischen Standard der am preußischen Hof entstandenen und gespielten Musik dieser Gattung kaum. Ob die vorliegende C-Dur-Sinfonia von Carl Heinrich oder von Johann Gottlieb Graun stammt, mag man vor dem Hintergrund des – bei allen individuellen Ausformungsmöglichkeiten – recht verbindlichen stilistischen Gattungsrahmens der Zeit und angesichts der musikalisch stabilen Erwartungshaltung des Königs als sekundär erachten. Und auch die Frage, ob es sich dabei um eine Opern-Sinfonia oder um eine für den Konzertsaal handelt – wahrscheinlicher ist der zweite Fall –, verliert an Bedeutung, wenn man sich die fließenden Grenzen, die gegenseitigen Einflüsse und den funktionalen Austausch dieser beiden Erscheinungsformen vor Augen hält.
Auch der Cembalist Christoph Schaffrath (1709 – 1763) kam vom Dresdener Hof zum preußischen Kronprinzen, und zwar – wie die Grauns – bereits in dessen Ruppiner Zeit, wahrscheinlich 1734. Es wird vermutet, dass Schaffrath, der 1740 zunächst in die Königliche Hofkapelle übernommen worden war, beim Engagement C. Ph. E. Bachs als Kammermusiker zu Friedrichs Schwester Anna Amalia wechselte. Zwar komponierte auch Schaffrath vorwiegend Musik für sein eigenes Instrument, es sind aber zudem eine Reihe von Werken in anderen der damals gefragten Genres überliefert. Seine Ouvertüre in d-Moll für Streichorchester ist, wie schon in der Bezeichnung –Ouvertüre, nicht Sinfonia – zum Ausdruck kommt, dem französischen Modell und Stil verpflichtet, dessen Charakter Quantz in seinem Versuch folgendermaßen beschreibt: „Eine Ouvertüre, welche zum Anfange einer Oper gespielet wird, erfordert einen prächtigen und gravitätischen Anfang, einen brillanten, wohl ausgearbeiteten Hauptsatz, und eine gute Vermischung verschiedener Instrumente, als Hoboen, Flöten, oder Waldhörner.” Allerdings bedauert Quantz schon 1752, dass solche Ouvertüren „in Deutschland nicht mehr üblich sind.” Der ‚gravitätische‘ Anfang französischer Ouvertüren ist, anders als im italienischen Konkurrenzmodell, durch langsames Tempo und scharf punktierte Rhythmik gekennzeichnet Die schnellen Abschnitte tragen häufig polyphone Züge und sind etwas dichter gearbeitet als Opern-Sinfonien. Wie diese aber, so wurden auch Ouvertüren französischen Zuschnitts nicht allein für die Opernbühne, sondern auch für den Konzertsaal geschrieben. Es ist sehr anzunehmen, dass es sich bei dem vorliegenden - übrigens auf die „Vermischung” mit Bläsern verzichtenden - Werk Schaffraths, der nicht für die Oper arbeitete, um eine Konzert-Ouvertüre handelt.
Nach einer musikalischen Ausbildung durch seinen Vater studierte Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788) in Leipzig und Frankfurt an der Oder Jura, war aber zugleich auch als Komponist und Cembalist tätig. 1738 stellte Friedrich ihn als Cembalist ein, womit neben den Brüdern Graun und J. J. Quantz – deren musikalische Wurzeln in Dresden lagen – ein weiterer bedeutender Musiker aus Sachsen in preußische Dienste trat. Verglichen mit diesen nahm Bach in der Hofkapelle jedoch eine weniger privilegierte Stellung ein, was sich auch in einem bescheideneren Gehalt manifestierte. Auch verließ Bach, anders als die Grauns oder Quantz, Friedrichs Dienste wieder und wurde 1768 als Nachfolger G. Ph. Telemanns Musikdirektor in Hamburg. C. Ph. E. Bach genoss europäischen Ruhm als Cembalist und Pädagoge, wozu auch sein Versuch über die wahre Art das Klavier Clavier zu spielen beigetragen hat. Dessen erster Teil wurde 1753 in Berlin publiziert, und Zeit und Ort waren kaum zufällig: 1750 erschien dort Fr. W. Marpurgs Kunst das Clavier zu spielen, 1752 Quantz’ Flötenschule und 1757 Joh. Fr. Agricolas Anleitung zur Singkunst (eine Übertragung von Pier Francesco Tosis bekanntem Lehrwerk). Ob Bach, der sich schon seit 1753 verschiedentlich auf andere, kirchliche Stellen bewarb und bei Hofe vermutlich weniger Anerkennung fand als Quantz oder Graun, mit seiner Potsdamer Anstellung unzufrieden war, ist umstritten. Dass er dort aber immerhin 30 Jahre blieb, dürfte jedenfalls auch mit seiner Teilhabe am bürgerlichen Berliner Kulturleben – und keineswegs nur am musikalischen – in Zusammenhang stehen. Jenseits der romantisch verkürzenden These, dass C. Ph. E. Bach dem musikalischen Konservatismus des Berliner Hofes zu entkommen trachtete, war er doch mit Sicherheit in musikgeschichtlicher Perspektive der innovativste und bedeutendste der Musiker aus Friedrichs Kapelle.
Der bei weitem überwiegende Teil von Bachs Solokonzerten ist für sein eigenes Instrument, das Cembalo, geschrieben und auch sein Konzert für Violoncello und Streichorchester in A-Dur liegt in einer Fassung mit konzertierendem Cembalo vor und darüber hinaus auch als Flötenkonzert. Welcher dieser Versionen Priorität zukommt, lässt sich nicht mit Sicherheit klären. Die Mehrfachverwertung mag aber von Anfang an intendiert gewesen sein, und die drei Erscheinungsformen des Konzerts tragen allemal der Idiomatik des jeweiligen Soloinstruments Rechnung. Das Recycling eigener Musik war im 18. Jahrhundert weithin üblich. C. Ph. E. Bach praktizierte es am intensivsten in seiner Vokalmusik. Aber auch sechs seiner Konzerte existieren in verschiedenen Versionen, drei davon als Cembalo-, Violoncello-, und Flötenkonzert. Auch Bach geht von der für die Gattung damals üblichen Ritornell-Form aus, doch das vorliegende Konzert – es stammt von 1753, wurde also mindestens zehn Jahre vor dem hier ebenfalls eingespielten Flötenkonzert Quantz' komponiert - zeigt seine etwas freiere, retrospektiv auch auf die spätere Entwicklung des Genres weisende Handhabung des Tonsatzes. Trotzdem sollte man, und dies gilt selbstverständlich für alle Musik des mittleren Drittels des 18. Jahrhunderts, die immer noch häufig zwischen die "Schubladen" von Barock und Klassik einsortiert wird, in den Worten E. Eigene Helms "in diesen Konzerten nicht eine Übergangsstufe zu Mozart sehen, sondern den eigenständigen uns selbstbewussten Höhepunkt des nordeutschen Konzertstils".
Martina Dallmann (Flöte)
Martina Dallmann studierte von 1975 bis 1982 an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin Querflöte. Die gebürtige Saalfelderin war Flötistin beim Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig. Seit 1993 beschäftigt sich Martina Dallmann intensiv mit historischer Aufführungspraxis. An der Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig absolvierte sie im Fach „Alte Musik“ mit dem Hauptfach Traversflöte ihr Studium bei Benedek Csalog. Weiterhin belegte sie Kurse u.a. bei Barthold Kuijken, Linde Brunmayr und Ton Koopman. Neben reger Unterrichtstätigkeit wirkt Martina Dallmann als Solistin und Orchestermusikerin in Konzerten und bei Aufnahmen namhafter Ensembles mit.
Martina Dallmann ist Mitbegründerin und Leiterin des 1998 gegründeten Barockensemble Concerto Brandenburg.
Martin Seemann (Violoncello)
Martin Seemann studierte bei Wolfgang Boettcher an der Hochschule der Künste in seiner Heimatstadt Berlin. Er beendete 1995 seine Ausbildung als Stipendiat der Heinrich Böll-Stiftung bei Ivan Monighetti in Basel. Seit 1987 nahm er regelmäßig an den Meisterkursen von Anner Bylsma teil.
Neben dem Standardrepertoire beschäftigt ihn einerseits die Interpretation der Musik des 17. – 19. Jahrhunderts auf dem Barockcello und dem Violoncello piccolo und andererseits die Aufführung zeitgenössischer Musik. So war er bei der Uraufführung von Arvo Pärts „Fratres“ in der Fassung für Violoncello und Orchester zu hören. Als Solist gastierte er in vielen europäischen Ländern, Kammermusikengagements führten ihn in die USA und nach Japan. Dem Barockensemble Concerto Brandenburg gehört er seit dessen Gründung im Jahre 1998 an.
Concerto Brandenburg
Das Barockensemble Concerto Brandenburg wurde 1998 in Berlin gegründet. Sein Repertoire umfasst Musik von der Zeit des Barocks bis zur Romantik mit einem Schwerpunkt auf Werken barocker Komponisten der Berliner Schule, deren Wiederbelebung sich das Ensemble besonders intensiv widmet.
Die Musiker von Concerto Brandenburg haben sich nach mehrjähriger Erfahrung in verschiedenen Sinfonie- und Opernorchestern auf das Spiel historischer Instrumente spezialisiert. Sie qualifizierten sich hierfür in Einzelunterricht und Aufbaustudiengängen an bekannten europäischen Ausbildungsstätten; ihre Interpretation erlangt so neben technischer Virtuosität eine besondere Sensibilität für den Charakter des Musikwerks.
Diese Beschäftigung mit historischer Aufführungspraxis, die das Profil von Concerto Brandenburg prägt, bedeutet für weite Kreise von Musikkennern inzwischen eine
geschätzte Annäherung an authentische Klangerlebnisse. In zunehmendem Maße wird die Musik auf den Instrumenten ihrer jeweiligen Entstehungszeit hörbar gemacht. Die klanglichen Ergebnisse überzeugen – sie begeistern sowohl Musiker als auch Zuhörer. Dabei sind die Wahl der Instrumente, Bögen und Saiten sowie die Verwendung historischer Stimmtonhöhen und Stimmungen ebenso ausschlaggebend wie die Erkenntnisse aus dem Studium musiktheoretischer Quellen, originaler Handschriften und von Notendrucken.
Als barocker Klangkörper arbeitete Concerto Brandenburg mit namhaften Interpreten und Dirigenten wie Robert Hill, Friedemann Immer, Ton Koopman und Stephan Mai zusammen.
In Oratorienaufführungen mit dem Philharmonischen Chor Berlin, dem Konzertchor Berlin sowie der Berliner Singakademie unter ihrem Leiter Achim Zimmermann sind Concerto Brandenburg zahlreiche erfolgreiche Interpretationen gelungen. Die Passionen und das Weihnachtsoratorium Johann Sebastian Bachs, „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel, das „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart, „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn und die „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi wurden mit verschiedenen Berliner Chören in Kirchen und an prominenten Spielstätten wie dem Konzerthaus Berlin/Schauspielhaus am Gendarmenmarkt und der Berliner Philharmonie aufgeführt.
Eine intensive Zusammenarbeit pflegt Concerto Brandenburg außerdem mit dem Goethe-Theater in Bad Lauchstädt, dessen Produktion von Wolfgang Amadeus Mozarts „Don Giovanni“ bereits in Bad Kissingen, Bad Lauchstädt, Bayreuth, Bonn und Schwetzingen viel Beachtung fand. In Darmstadt spielte Concerto Brandenburg 1999 den „Freischütz“ von Carl Maria von Weber, der hier erstmalig in Europa auf historischen Instrumenten erklang.
Wechselnde, der Literatur angepasste Besetzungen sind charakteristisch für Concerto Brandenburg: der Individualität des Musikwerks folgend variiert das Auftreten vom Quartett über verschiedenste Kammermusik- und Barockorchesterbesetzungen – mit einer für die Zeit typischen, farbigen Continuo-Gruppe in der Besetzung Violoncello, Fagott, Kontrabass, Laute und Cembalo – bis hin zum großbesetzten romantischen Orchester.
Concerto Brandenburg hat sich in der traditionsreichen und lebendigen Musikkultur der Hauptstadt Berlin und der Region Brandenburg in nur wenigen Jahren als Institution etabliert. Das Orchester behauptet erfolgreich seine Präsenz und Beliebtheit in der anspruchsvollen regionalen Konzertszene und genießt mittlerweile auch deutschlandweit und international unter Kennern der „Alten Musik“ eine kontinuierlich wachsende Reputation.
Besetzung
Violine: Thomas Graewe (Konzertmeister), Matthias Hummel (Konzertmeister), Katharina Arendt, Angela Brandigi, Bettina Ecken, Birgit Fischer, Christiane Hinze,
Almut Schlicker, Beate Voigt, Ulrike Wildenhof, Dagmar Zieger
Viola: Aino Hildebrandt, Ernst Herzog, Käthe Dorothee Kaye, Franziska Weiß
Violoncello: Martin Seemann, James Bush, Bettina Messerschmidt
Kontrabass: Laszlo Francu-Tamas
Flöte: Martina Dallmann
Fagott: Christian Walter
Laute: Ophira Zakai
Cembalo: Beni Araki, Mark Nordstrand
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden